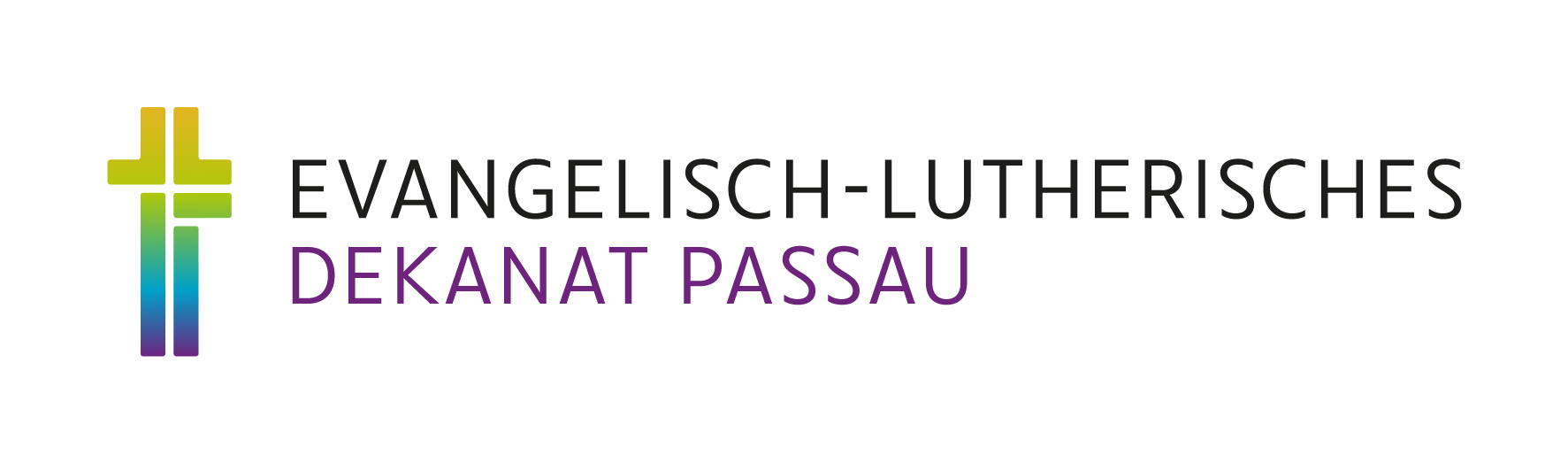Wilfried Helm (li) von den Wochen zur Demokratie eröffnete das Zeitzeugengespräch am 9. November in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Passau. (v.l.n.r.) Historikerin Dr. Linda von Keyserlingk-Rehbein, die Zeitzeugen Bernd Dämmrich und seine Tochter Dr. Ute Willersinn in Vertretung ihrer Mutter Elke Dämmrich, sowie Jessica Kreutz Professorin für Historische Bildung und Public History an der Uni Passau.
In dem von Dr. Linda von Keyserlingk-Rehbein moderierten Gespräch gaben die Zeitzeugen einen Einblick in das Leben in der DDR-Diktatur. Zu dem Gespräch hatten das Labor für Demokratiebildung der Universität Passau, die Reiner und Elisabeth Kunze Stiftung, die Initiative Wochen zur Demokratie und das Evangelisch-Lutherische Dekanat Passau eingeladen.
In ihren einleitenden Worten zum Zeitzeugengespräch „Diktaturerfahrungen in der DDR“ stellte Dr. Linda von Keyserlingk-Rehbein, Geschäftsführerin des Labors für Demokratiebildung, das erst kürzlich gegründete Labor vor und bezeichnete den 9. November, als Tag der Licht- und Schattenseiten der deutschen Geschichte vereine. Zurzeit erleben wir einen Zulauf auch junger Menschen zu extremen Parteien mit autokratischen Zügen. Im Labor für Demokratiebildung der Universität Passau werden deshalb Angebote für die demokratische Bildung entwickelt.
„Wir waren keine Widerständler, wir wollten nur nicht mitmachen“, so fasste Bernd Dämmrich seine Haltung und die seiner Frau Elke zum DDR-Staat zusammen. Er und seine Frau wurden vor 83 Jahren in Thüringen geboren und mussten miterleben, wie der DDR-Staat sie als junge Menschen systematisch in ihren beruflichen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten ausbremste. Sie waren Akademikerkinder, gehörten später der Jungen Gemeinde in Leipzig an, wollten nicht der Einheitspartei angehören und auch nicht für die Stasi arbeiten. Damit waren sie nicht linientreu genug und mussten mit staatlichen Repressalien leben.
Bernd Dämmrich schaffte es dann auch ohne die Oberschule Ingenieur zu werden und Elke Dämmrich wurde durch die Intervention ihrer Eltern Kieferorthopädin. In der gut besuchten St.-Matthäus-Kirche erzählte Bernd Dämmrich, dass er sich seit seiner Jugend über das Westradio mit Informationen jenseits der DDR-Propaganda, versorgte. „Ich habe schon als Jugendlicher daran gedacht, die DDR zu verlassen.“ Sein Antrag auf Besuch seines im Westen lebenden Vaters wurde ohne Begründung abgelehnt.
Ihren beiden Kindern wollten die Dämmrichs die staatliche Unterdrückung ersparen und versuchten 1977 einen Fluchtversuch über Warschau. Zu diesem Zeitpunkt wurden sie jedoch bereits durch die Stasi überwacht und die Flicht scheiterte. Sie wurden wegen „Republikflucht“ zu vier bzw. dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
Die sieben und vier Jahre alten Kinder wurden voneinander getrennt und in Kinderheime für Schwererziehbare gesteckt. „Die Erfahrung von Menschlichkeit war dort unmöglich“ zitierte Dr. Ute Willersinn ihre Mutter Elke. Durch diese Zeit im Kinderheim habe Tochter Ute die letzten Worte ihrer Mutter „Alles wird gut“ getragen. Nach eineinhalb Jahren gehörte die Familie Dämmrich zu den rund 33.000 politischen Häftlingen, die von der Bundesrepublik freigekauft wurden. In Niederbayern konnten sie einen Neuanfang machen.
Im Zeitzeugengespräch gibt Elke Dämmrich aus dem Munde ihrer Tochter jungen Menschen mit auf den Weg die Sprache als Kulturgut zu pflegen: „Sie ist unabdingbar für fundierte Streitgespräche und Diskussionen." Nur Bildung mache es möglich, „Populismus und Hetze von fundiertem Wissen zu unterscheiden“. Bernd Dämmrich hat die Erfahrung gemacht, dass die Diktatur das Leben in der Familie, im Staat und auf der Welt bestimmt. „Nur die Demokratie garantiert Freiheit.“
Professorin Jessica Kreutz betonte, dass solche authentischen Berichte einen „Spiegel der Vergangenheit“ darstellten und einen wichtigen Zugang zu ihr böten. Bei Zeitzeugengesprächen werde die Schilderung der persönlichen Geschichte erst Geschichte wirklich greifbar. Sie seien das Schmieröl für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und bei Familie Dämmrich sei Demokratie spürbar eine Herzensangelegenheit.
Text und Foto: Hubert Mauch